Nein, auch du brauchst keinen Digital Detox

Digital Detox ist eigentlich ganz einfach: Man nehme die Wirren von Ein-, Um-, und Auszügen, einen arbeitsscheuen Techniker und herauskommt: Eine Online-Redakteurin respektive Internetkind der ersten Stunde ohne WLAN in der Wohnung. Für zwei volle Wochen – mein ganz persönlicher Jackpot. Was als unfreiwilliger Digital Detox begann und sich als nervenzehrendes Caféhopping und Hotspot-Schnorren fortsetzte, endete mit einigen Erkenntnissen über das Leben im digitalen Zeitalter, der eigenen Online-Filterblase und der Frage, ob das oftmals gerühmte Internetfasten tatsächlich die Lösung allen sozialmedial verursachten Übels ist.
Wer in der Medienwelt arbeitet oder sich auch ohne Bezahlung ein bisschen zu viel im Netz aufhält (also quasi alle Menschen zwischen 10 und 35) stößt seit einigen Jahren immer wieder über den Begriff des "Digital Detox", das digitale Fasten. Das bedeutet, für eine gewisse Zeit auf den Konsum und die Verwendung digitaler Medien zu verzichten. Das Heilsversprechen: Nicht weniger als der höchstmögliche Seelenfrieden im Informationszeitalter. Weil wir tagtäglich bewusst und unbewusst mehrere Kilometer (grobe Schätzung) mit dem Scrolldaumen auf dem Smartphonebildschirm zurücklegen, sich die Newsfeeds ständig selbst aktualisieren und die visuelle Überreizung durch Instagram, Snapchat, Twitter, Tinder und der BVG-App für unser analog programmiertes Gehirn einfach zu viel ist. Die Folge: Stress. Sagen Wissenschaftler, sagen deine Eltern und mindestens drei von deinen vernünftigen Freunden, die früher ein GEOlino-Abo hatten.
Das Netz ist Teil des Alltags – und so sollten wir es auch behandeln
Und ich gebe es zu: Es ist in der Tat erholsam. So in etwa eine halbe Stunde lang. In diesen ersten Minuten ohne Internet nehme ich mir vor, jetzt eben eine Weile in Cafés zu schreiben, mich aus Zeitungen zu informieren oder endlich mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen wie die anderen schlauen Kinder. Nach 31 Minuten greife ich zum Telefon und rufe meinen Netzanbieter an, um nach einer Übergangslösung zu fragen. „Sie haben doch bestimmt einen Internet-Stick oder sowas?“, hauche ich verzweifelt in den Hörer, meine Telefonphobie ignorierend, denn im Angesicht wahrer Not hat Angst keinen Platz. Einen Stick, ja, den haben sie und zwei Tage später habe ich ihn. Das verfügbare Datenvolumen reicht für zwei Emails, ein halbes Youtube-Video und drei gegoogelte Symptome. Wenigstens kein Krebs.
Es ist in der Tat erholsam. So in etwa eine halbe Stunde lang.
Also auf ins nächstgelegene Café. Menschen ohne festes Büro sind in Berlin keine Seltenheit und wenn die es schaffen, produktiv neben röhrenden Kaffeemaschinen, schnatternden Gästen und dem Geruch von frisch gebratenem Tofu zu arbeiten, kann ich das ja wohl auch. „Wenn du dich mal so richtig bilden willst“, sagt die eine Kellnerin zur anderen, während ich ernsthaft versuche, mich zu konzentrieren, „dann schau dir diese Videos an. Die sind richtig mit Philosophie und so. Kant, Karl Mars, kennste.“ Karl Mars, hihi. Ob der wohl mit Bruno verwandt ist?
Ich schäme mich für meine bildungsbürgerliche Hybris und nippe an meiner bodenständigen Apfelschorle, das erdet. Fazit: Im Café arbeiten funktioniert nur mit Kopfhörern und einer minutiösen To-Do-Liste, sonst belausche ich Mitmenschen oder bestelle Quatsch im Internet, einfach aus purer Freude darüber, dass es geht. Aber ja, die Flamingogießkanne brauche ich wirklich.
Die befreienden Spitzen eines klassischen Detox bleiben aus: Ich lese nicht mehr Bücher, ich telefoniere nicht öfter, ich fühle mich nicht befreit.
„Ich hab mich gestern wieder so aufgeregt über ihre Snaps, diese Person ist einfach so unfassbar dumm“, höre ich dann ein paar Tage später ein Gespräch in der Bahn mit. Abgesehen davon, dass ich vielleicht ein Lauschproblem habe, frage ich mich an dieser Stelle: Warum schaust du es dir dann an? Dieser klassische Fall von „Hatewatch“ ist die direkte Folge davon, nicht bewusst auszuwählen, was man eigentlich im Netz sehen will und was nicht – vielleicht noch ein gepaart mit einer Prise Voyeurismus. Alles in allem nichts, was man nicht steuern und den dadurch entstehenden Stress komplett vermeiden könnte. Es hilft immens, bewusst die eigenen Feeds und Followings zu kuratieren – auch wenn das bedeutet, enge Freunde auf Facebook stumm zu schalten oder den neuesten Hype erst ein paar Tage später mitzubekommen.
Die digitale Entgiftung ist nichts anderes als eine virtuelle Crashdiät
Während ich also weiter gezwungenermaßen an öffentlichen Orten meinen dunklen Machenschaften im Darknet nachgehe, stellt sich nach einigen Tagen eine gewisse knirschende Akzeptanz der Situation ein. Allerdings bleiben die befreienden Spitzen eines klassischen Detox aus: Ich lese nicht mehr Bücher, ich telefoniere nicht öfter, ich fühle mich nicht befreit. Umgekehrt habe ich aber auch nicht das Gefühl, etwas zu verpassen, denn mit etwas Abstand vom Bildschirm wird schnell klar: So wichtig und weltbewegend ist das Meiste gar nicht, was da so abgeht. Klar würde ich gerne mein erfolgreich selbst an die Wand geschraubtes Regal mit der Welt teilen, ein paar schulterklopfende Likes und einen „Das ist ja voll schief!“-Kommentar dafür einfahren. Aber der Impuls geht nach ein paar Sekunden weg und das Leben weiter. Als sich Freunde über ein akut hochgradig virales Video beömmeln, kann ich natürlich nicht mitlachen. Das finde ich kurz doof und dann aber schnell auch ziemlich egal. Trotzdem denke ich weiter über mein unfreiwilliges Abgeschnittensein nach.
Es stigmatisiert das Internet als einen Ort des Unheils, vor dem man sich am besten regelmäßig in die rettende Abstinenz flüchtet.
Abgesehen von allen inhaltlichen Bedeutungsebenen finde ich allein schon den Begriff des „Digital Detox“ irreführend. Als wäre das Netz etwas grundlegend Schädliches, von dem man sich entgiften müsse. So gesehen wäre ein Detox in etwa so sinnvoll, wie eine Woche lang mit dem Rauchen aufzuhören und dann wieder anzufangen. Es stigmatisiert das Internet als einen Ort des Unheils, vor dem man sich am besten regelmäßig in die rettende Abstinenz flüchtet. Tatsächlich passiert im Netz viel Schlimmes, viel Unrecht oder auch nur ganz banale menschliche Dummheit. Die passiert aber in der Welt da draußen genauso und hier wie dort sollte niemand die Augen davor verschließen. Besonders nicht, wer mit dem Internet als konstante Zweitrealität großgeworden ist und über entsprechend gut ausgeprägte Verarbeitungsmechanismen verfügt.
Der "DD" scheint vor allem ein Lifestyle-Trend zu sein, ein symbolischer Akt der Befreiung. Jene, die ihn öffentlichkeitswirksam vollziehen, fallen danach wieder zurück in den üblichen, willenlosen Klicktrott wie einer Crashdiät. Da das Internet aber in den nächsten Jahren voraussichtlich noch mehr als heute unseren Alltag durchfasern und mitbestimmen wird, ist es mehr als nur eine präventive Schutzmaßnahme, sich einen für sich gesunden Umgang mit der digitalen Welt zu finden.
Die Lösung: Sortieren, reflektieren, deabonnieren
Nach zwei vergleichsweise unproduktiven, aber sich trotzdem noch normal anfühlenden Wochen erlöst mich eine Engelserscheinung in Form eines Technikers von meinem kalten Netzentzung. Der nun funktionierende Router leuchtet auf und ich bilde mir ein, dass er meinen innigen Zungenkuss erwidert. Meine mediale Ernährungspyramide ist wieder betriebsfähig. Und trotzdem geht mir nicht aus dem Kopf, was für ein krudes Konzept so ein Digital Detox eigentlich ist. Viel nachhaltiger ist es, sich gar nicht erst in die Situation zu bringen, ihn nötig zu haben. Proaktiv auszuwählen, mit welcher Art von Nachrichten man in welcher Frequenz konfrontiert wird ist kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Fast nichts ist im Netz nicht personalisierbar, jeder kann sich seine eigene Blase bauen und sie nach Belieben umgestalten.
Viel nachhaltiger ist es, sich gar nicht erst in die Situation zu bringen, einen Digital Detox nötig zu haben.
Als Digital Native heißt das vor allem, genügend kritischen Reflexionsabstand zur Informationsflut zu gewinnen und analoge Korrektive für die digitale Gegenwart zu finden. Und sich zudem einen guten Blick dafür anzutrainieren, wenn es um die Bewertung von Meldungen und Posts geht. Muss ich das wissen? Muss ich das genau jetzt lesen oder beantworten? Oft lautet die Antwort: Nein. An dieser Stelle hat die Online- gegenüber der Offlinewelt einen großen Vorteil: Was einen stresst, kann man ziemlich leicht vermeiden oder abschalten und sich umso mehr auf Dinge konzentrieren, die einen interessieren, inspirieren oder unterhalten. Davon gibt’s glücklicherweise eine Menge – vor genauso wie auf dem Bildschirm.
Und jetzt entschuldigt mich, ich muss surfen.
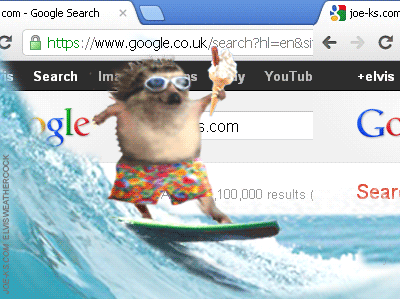

 Ilona Hartmann
Ilona Hartmann 

